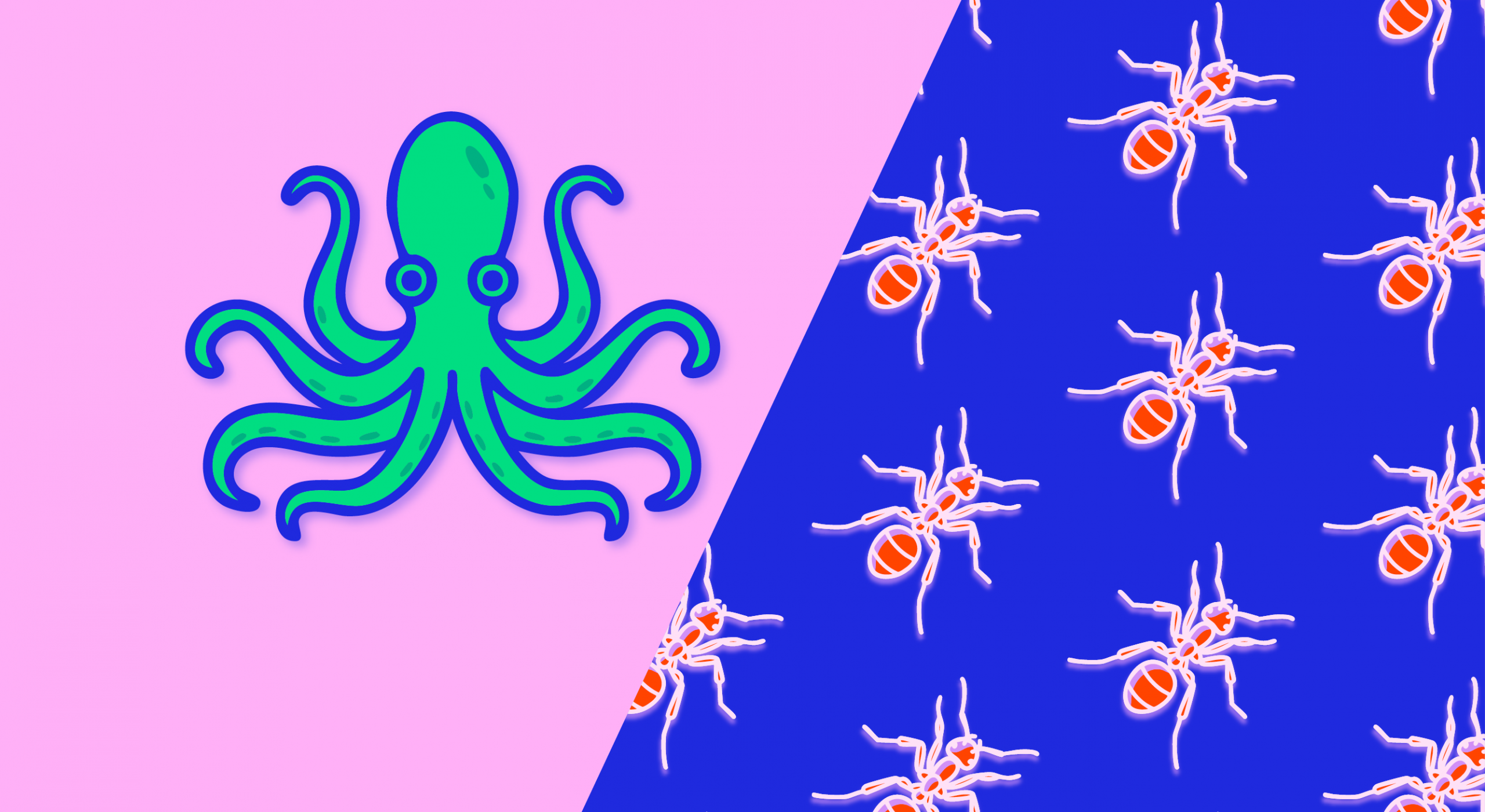von Dennis Völzke
Datensicherung ist weit mehr als ein technisches Detail. Sie ist ein zentraler Bestandteil unternehmerischer Resilienz. Studien zeigen, dass bei einem Großteil der heutigen Ransomwareangriffe gezielt versucht wird, auch die Backupsysteme zu kompromittieren. In vielen Fällen gelingt das, was dazu führt, dass selbst regelmäßig erstellte Sicherungskopien im Ernstfall unbrauchbar sind.
Trotz dieser Bedrohungslage fehlt es in vielen Organisationen an einer klar dokumentierten Backup- und Wiederanlaufstrategie. Stattdessen wird häufig auf Systeme vertraut, die im Krisenfall weder belastbar noch gegen Manipulation geschützt sind.
Dieser Artikel zeigt sieben typische strukturelle Schwächen in Backupkonzepten mittelständischer Unternehmen und erklärt, wie sich diese systematisch, revisionssicher und wirtschaftlich tragfähig beheben lassen.
Reality Check
In vielen Unternehmen gilt die Datensicherung als erledigt, weil irgendwo ein Backup läuft. Doch die Realität sieht oft anders aus. Systeme sind lückenhaft, Wiederherstellungen ungeplant und Verantwortlichkeiten unklar.
Was häufig übersehen wird:
- Wiederherstellbarkeit: Backups sind vorhanden, aber der Ernstfall ist nie geprobt. Ohne klaren Wiederherstellungsprozess helfen auch tägliche Sicherungen nicht
- Georedundanz: Daten und Sicherungen liegen zu nah beieinander. Brände, Einbrüche oder Angriffe können beides gleichzeitig zerstören
- Berechtigungen: Zugriffe sind nicht ausreichend abgesichert. Wer Backups löschen kann, kann sie auch unbrauchbar machen, intern wie extern
- Cloud: Cloud ersetzt kein eigenes Backup. Was gelöscht ist, bleibt oft weg, besonders bei Anwendungen mit eingeschränkten Wiederherstellungsoptionen
- Verantwortungsdispersion: Niemand ist wirklich zuständig. In vielen Fällen weiß im Notfall niemand, wer handeln darf oder muss
- Strategie: Jedes System wird anders gesichert. Ohne zentrale Strategie entstehen Lücken und niemand erkennt sie rechtzeitig
- Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser: Fehler bleiben unbemerkt. Ohne regelmäßige Kontrolle fällt es oft erst zu spät auf, dass etwas schiefgelaufen ist
7 Schwachstellen
Schwachstelle #1: Backups existieren, aber die Wiederherstellung ist ungewiss
In vielen Unternehmen werden regelmäßig Datensicherungen durchgeführt, sei es automatisiert über Backup-Software oder manuell durch IT-Verantwortliche. Dennoch bleibt eine zentrale Frage häufig unbeantwortet: Können diese Backups im Ernstfall zuverlässig und vollständig wiederhergestellt werden?
Tatsächlich zeigen Studien, dass nur rund 50 Prozent der Unternehmen ihre Backups regelmäßig auf Wiederherstellbarkeit testen. Die übrigen scheitern an defekten Datenständen, fehlenden Berechtigungen oder ungeplanten Komplexitäten beim Restore .
Ein ungetestetes Backup ist ein potenzielles Risiko. Im Ernstfall kommt es nicht darauf an, ob eine Sicherung vorhanden ist, sondern ob sie schnell und vollständig zurückgespielt werden kann, idealerweise in klar definierten Zeitrahmen. Die fehlende Definition von RTO (Recovery Time Objective) und RPO (Recovery Point Objective) führt häufig dazu, dass keine unternehmerisch tragfähige Wiederanlaufstrategie besteht.
Ein paar Statistiken
- 34% der Backups werden modifiziert oder gelöscht
- Weniger als 10% schaffen es über 90% ihrer Server wiederherzustellen
- Gerade einmal 51% der Unternehmen können überhaupt den Großteil ihrer Server wiederherstellen
Empfohlene Maßnahmen
- Die Wiederherstellbarkeit sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, mindestens einmal jährlich mit vollständigem Recovery-Test, ergänzt durch quartalsweise Teiltests (z. B. Einzeldateien, VM, Restores).
- RTO und RPO sollten unternehmensweit abgestimmt und dokumentiert sein, idealerweise pro Anwendungsklasse.
- Ergebnisse von Restore-Tests protokollieren und auswerten
Eine regelmäßige Überprüfung der tatsächlichen Wiederanlauffähigkeit verbessert nicht nur die technische Resilienz, sondern stärkt auch die Position gegenüber Auditoren, Versicherern und Kunden, die zunehmend konkrete Nachweise für funktionierende Business, Continuity, Maßnahmen erwarten.
Schwachstelle #2: Backups werden am selben Ort gespeichert wie die Produktivsysteme
In zahlreichen Unternehmen werden Backups zwar regelmäßig erstellt, jedoch am gleichen physischen oder logischen Standort wie die originären Produktivdaten gespeichert, beispielsweise im gleichen Rechenzentrum, auf demselben Server oder in einem über das gleiche Netzwerk erreichbaren Speicher. Diese Praxis stellt ein erhebliches Risiko dar.
Kommt es zu einem Brand, Wasserschaden, Stromausfall, Diebstahl oder einem gezielten Cyberangriff, besteht die Gefahr, dass sowohl die Primärsysteme als auch die Sicherungen gleichzeitig betroffen sind, mit der Folge eines vollständigen Datenverlusts. Besonders bei Ransomware, Angriffen zeigt sich, dass nicht nur Daten verschlüsselt werden, sondern gezielt versucht wird, auch Backup-Repositories unbrauchbar zu machen.
In rund 93 % der dokumentierten Ransomware-Angriffe werden gezielt auch Backups attackiert, etwa durch Verschlüsselung, Löschung oder Ausnutzung privilegierter Zugänge.
In solchen Fällen steht selbst bei regelmäßiger Sicherung keine verwertbare Kopie mehr zur Verfügung.
Empfohlene Maßnahmen
- Umsetzung der 3, 2, 1, Backup, Regel: Mindestens drei Kopien von allen kritischen Daten, auf zwei unterschiedlichen Medientypen, davon mindestens eine Kopie außerhalb des primären Standorts (z. B. Cloud oder Offline-Medium).
- Optional Erweiterung zur 3, 2, 1, 1, 0, Regel: Eine unveränderbare („immutable“) oder vollständig vom Netz getrennte Kopie + regelmäßige Prüfung auf Fehlerfreiheit.
- Physikalische Trennung von Primärdaten und Backupsystemen, insbesondere bei lokalen Installationen oder Hybridumgebungen.
- Einrichtung eines georedundanten Speicherorts oder die Nutzung professioneller Cloud-Backup-Infrastrukturen, um standortbezogene Risiken zu minimieren.
Die georedundante Speicherung von Backups ist keine Frage des Luxus, sondern ein essenzieller Bestandteil jeder belastbaren IT-Resilienzstrategie. Ohne physische oder logische Trennung besteht jederzeit die Gefahr, dass ein einzelnes Ereignis sowohl operative Systeme als auch alle Sicherungskopien zerstört.
Schwachstelle #3: Backups sind manipulierbar, intern wie extern
Auch wenn Backups räumlich getrennt gespeichert oder regelmäßig durchgeführt werden, bleibt eine oft übersehene Schwachstelle bestehen. Die Sicherungen selbst können manipulierbar oder löschbar sein, zum Beispiel durch externe Angriffe, interne Fehler oder unzureichend geschützte administrative Zugänge.
Aktuelle Angriffsmuster zeigen, dass viele Bedrohungsakteure nicht mehr nur auf operative Systeme abzielen. Zunehmend geraten auch Sicherungsprozesse und Speichersysteme in den Fokus. Dabei nutzen Angreifer häufig legitime Verwaltungstools, um sich unbemerkt im Netzwerk zu bewegen und Sicherungen gezielt zu löschen, zu verschlüsseln oder zu überschreiben. Zusätzlich bestehen Risiken durch fehlerhafte Automatisierungen, unklare Berechtigungen oder bewusst manipulierte Abläufe.
Diese Entwicklung führt dazu, dass selbst technisch gut aufgestellte Backupsysteme im Ernstfall nicht mehr vertrauenswürdig oder gar vollständig funktionslos sein können, und zwar ohne dass der Schaden sofort sichtbar wird.
Empfohlene Maßnahmen
- Einführung von Immutable Backups: Sicherungskopien, die über einen definierten Zeitraum technisch nicht veränderbar oder löschbar sind (z. B. WORM, Speicher, Write-once-Cloud-Repositories).
- Anwendung des Zero-Trust-Prinzips: Jeder Zugriff auf Backupsysteme wird strikt kontrolliert, insbesondere bei administrativen Berechtigungen. Zugriff nur mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und nach dem Least-Privilege-Prinzip.
- Trennung von Backup-Management und Produktionssystemen: Administration über separate Zugänge, Netzwerksegmente und Monitoring, Strukturen.
- Einsatz von revisionssicherem Logging: Alle Backup-Operationen müssen lückenlos protokolliert und regelmäßig überprüft werden, auch zur Absicherung im Hinblick auf Compliance und Versicherbarkeit.
Ein funktionierendes Backup schützt nur dann, wenn es auch unangetastet bleibt. Die technische und organisatorische Absicherung der Sicherungen selbst ist daher eine Pflichtaufgabe in jeder modernen Backup-Strategie, besonders unter den aktuellen Bedrohungsszenarien, in denen Angreifer gezielt und systematisch Sicherungslösungen außer Kraft setzen.
Schwachstelle #4: Trügerische Sicherheit durch Cloud und SaaS, Dienste
Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Plattformen wie Microsoft 365, Google Workspace oder Salesforce entsteht oft der Eindruck, dass zusätzliche Backups überflüssig seien. Tatsächlich gilt in fast allen Public-Cloud- und SaaS-Modellen das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung: Während der Anbieter die Infrastruktur absichert, liegt der Schutz der Inhalte beim Kunden. Laut einer Marktanalyse verfügen jedoch nur 27 Prozent der Unternehmen, die Microsoft 365 nutzen, über eine umfassende Strategie zum Schutz und zur langfristigen Sicherung ihrer Daten.
Ein Großteil der Anbieter bietet lediglich eingeschränkte Wiederherstellungsoptionen, etwa über einen Papierkorb oder zeitlich begrenzte Versionshistorien. Diese reichen nicht aus, um:
- versehentliche Löschungen nach Ablauf der Wiederherstellungsfrist,
- gezielte Angriffe auf Benutzerkonten oder
- Datenverluste durch fehlerhafte Synchronisationen auszugleichen.
Besonders kritisch wird es, wenn rechtliche Anforderungen wie die DSGVO oder branchenspezifische Compliance, Vorgaben greifen: Ohne eigene Backup, Lösung ist eine revisionssichere, langfristige Datenverfügbarkeit in vielen Fällen nicht gewährleistet.
Empfohlene Maßnahmen
- Implementierung einer eigenständigen Backuplösung für SaaS, Plattformen, insbesondere für E-Mail, Kalender, Dateien, SharePoint, OneDrive oder Teams.
- Definition einer unternehmensweiten Cloud-Datenstrategie, die Backup, Archivierung und Compliance, Anforderungen integriert.
- Überprüfung der Vertragsbedingungen und Service Level Agreements (SLAs) mit Cloud, Anbietern hinsichtlich Datenwiederherstellung und Zugänglichkeit.
Cloud und SaaS Lösungen bieten zweifellos hohe Flexibilität, doch die Verantwortung für die Datensicherheit endet nicht beim Anbieter. Ein professionelles Backupkonzept muss deshalb auch alle ausgelagerten Plattformen vollständig einbeziehen, um einen realen Schutz gegen Datenverlust zu gewährleisten.
Schwachstelle #5: Unklare Zuständigkeiten, Backup ohne Verantwortliche
In vielen Organisationen ist die Datensicherung zwar technisch vorhanden, jedoch organisatorisch unzureichend eingebettet. Häufig sind Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt, es fehlen Vertretungsmodelle und es existiert keine vollständige Dokumentation der Sicherungsprozesse.
Das führt zu mehreren Risiken:
- Im Falle von Krankheit oder Personalwechseln fehlt das Wissen für die Durchführung oder Wiederherstellung
- Im Ernstfall ist unklar, wer welche Entscheidungen treffen darf oder muss
- Gegenüber Prüfstellen oder Versicherern fehlt es an belastbaren Nachweisen
Hinzu kommt, dass operative Belastungen häufig dazu führen, dass strategische Aufgaben wie Wiederherstellungsplanung, Tests oder Dokumentation vernachlässigt werden. Backups werden in der Folge als rein technische Routine verstanden, nicht als kritischer Bestandteil der Geschäftsresilienz.
Empfohlene Maßnahmen
- Ein schriftliches Backupkonzept definieren, das regelmäßig aktualisiert wird. Es sollte Informationen zu Sicherungszielen, Intervallen, Speicherorten und Wiederherstellungsprozessen enthalten.
- Zuständigkeiten klar Regeln. Dabei sollte zwischen operativer und strategischer Verantwortung unterschieden werden.
- Ein Vertretungsmodell einführen, in dem mindestens zwei Personen alle relevanten Aufgaben übernehmen können.
Ohne klare Zuständigkeiten und dokumentierte Prozesse kann eine Wiederherstellung im Notfall scheitern – nicht wegen technischer Fehler, sondern weil niemand weiß, was zu tun ist. Eine professionelle Backupstrategie erfordert daher nicht nur verlässliche Systeme, sondern auch ein solides organisatorisches Fundament.
Was gehört zu einem professionellen Backupkonzept?
Ein professionelles Backupkonzept geht weit über die technische Durchführung von Sicherungen hinaus. Es beschreibt strukturiert, wie Daten im Unternehmen gesichert, überprüft und im Ernstfall wiederhergestellt werden, mit klaren Zielen, Zuständigkeiten und Verfahren.
Folgende Bestandteile sollte ein vollständiges Backupkonzept enthalten:
- Backup, Ziele (RTO & RPO): Wie schnell müssen Systeme wiederhergestellt sein? Wie viel Datenverlust ist tolerierbar?
- Verantwortlichkeiten: Wer ist operativ und wer strategisch für die Datensicherung zuständig?
- Sicherungsumfang: Welche Systeme, Anwendungen und Daten werden gesichert, in welcher Frequenz, mit welchen Methoden?
- Speicherstrategie: Wo werden die Backups gespeichert (lokal, Offsite, Cloud), mit welchen Schutzmechanismen (z. B. Immutable, Verschlüsselung)?
- Wiederherstellungsplan: Welche Schritte sind im Notfall vorgesehen? Wer entscheidet über Restore, Abläufe und Prioritäten?
- Dokumentation & Auditfähigkeit: Wie werden Sicherungen, Tests und Änderungen dokumentiert und kontrolliert?
- Kontroll, und Testzyklen: Wie oft und in welchem Umfang werden Backups getestet und geprüft?
Ein solches Konzept schafft nicht nur technische Verlässlichkeit, sondern ist auch ein wichtiger Nachweis gegenüber Auditoren, Versicherern und der Geschäftsführung. Es zeigt, dass das Unternehmen seine Datenstrategie aktiv steuert, und nicht dem Zufall überlässt.
Schwachstelle #6: Keine systematische Kontrolle, Backups ohne Sichtbarkeit
In vielen Organisationen wird die Durchführung von Sicherungsprozessen als ausreichende Maßnahme angesehen. Was dabei häufig übersehen wird: Ob die Sicherung tatsächlich erfolgreich war, vollständig durchgeführt wurde und im Ernstfall auch wiederherstellbar ist, bleibt oft ungeprüft.
Dies kann dazu führen, dass Fehler wie beschädigte Dateien, fehlerhafte Sicherungsaufträge oder Speicherengpässe unbemerkt bleiben und erst im Ernstfall entdeckt werden.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ungewöhnliche Vorgänge oder gezielte Angriffe auf die Sicherungsinfrastruktur nicht erkannt werden, wenn keine zentrale Überwachung existiert. Gerade bei Angriffsszenarien wie Ransomware ist eine frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Sicherungsverläufe oder unerwarteter Änderungen entscheidend.
Empfohlene Maßnahmen
- Einrichtung eines automatisierten Monitoring, Systems mit E-Mail, oder Dashboard, Benachrichtigungen bei Fehlern, Abweichungen oder ungewöhnlichem Verhalten.
- Tägliche Kontrolle aller Backup, Logs und Sicherungsberichte, automatisiert, aber mit Verantwortlichem zur finalen Prüfung.
- Etablierung eines Eskalationsverfahrens bei fehlgeschlagenen Sicherungen oder Sicherheitsvorfällen.
- Nutzung von Backuplösungen mit integrierter Anomalie, Erkennung, um auf potenzielle Angriffe oder interne Fehler frühzeitig reagieren zu können.
Ein Backup, das nie kontrolliert wird, ist letztlich eine unsichere Annahme, kein verlässlicher Schutz. Eine strategisch verankerte Backup-Kontrolle schafft hingegen Transparenz, Verlässlichkeit und Revisionssicherheit, und ist damit ein unverzichtbares Element jeder professionellen Backuparchitektur.
Schwachstelle #7: Heterogene IT, aber keine einheitliche Backupstrategie
In vielen Unternehmen ist die IT-Landschaft über Jahre hinweg gewachsen. Lokale Server, virtuelle Maschinen, Cloud-Dienste und mobile Geräte werden parallel betrieben, oft ohne einheitliches Sicherungskonzept. Was häufig fehlt, ist eine zentrale Backupstrategie, die alle Systeme und Datenquellen konsistent einbindet.
Stattdessen werden Sicherungen je nach System, Abteilung oder Standort unterschiedlich durchgeführt. Das führt zu einer fragmentierten Sicherungsarchitektur, in der Lücken leicht übersehen werden. Besonders problematisch ist, dass neue Technologien wie cloudbasierte Anwendungen, externe Speicherlösungen oder mobile Arbeitsplätze häufig nicht systematisch in die Datensicherung aufgenommen werden. Dadurch entstehen ungeschützte Bereiche, etwa in Zusammenarbeitstools oder dynamischen Datenquellen, die im Ernstfall zu Datenverlust führen können.
Empfohlene Maßnahmen
- Entwicklung einer zentrale Backup-Strategie, die alle Systeme (physisch, virtuell, cloudbasiert) einbezieht, unabhängig vom Standort oder der Systemart.
- Einsatz einer plattformübergreifenden Backup-Lösung, die sowohl lokale als auch Cloud, Umgebungen zuverlässig abdeckt.
- Festlegung klarer Backup, Ziele (z. B. Aufbewahrungsfristen, Wiederherstellungszeiten) pro Anwendungsklasse, von kritischen Geschäftssystemen bis zu temporären Arbeitsdaten.
- Regelmäßige Aktualisierung der Backuparchitektur bei Einführung neuer Dienste oder Systeme, in enger Abstimmung mit dem IT, Management.
Eine moderne Backup-Strategie muss die gesamte IT, Infrastruktur abbilden, unabhängig davon, wo die Daten liegen oder wie sie erzeugt werden. Nur so lässt sich eine konsistente, überprüfbare und langfristig belastbare Datensicherung gewährleisten, auch in dynamischen IT, Umgebungen.
Backup ≠ Archivierung: Zwei unterschiedliche Aufgaben
mit unterschiedlichen Zielen
In der Praxis werden Backup und Archivierung häufig verwechselt oder vermischt, dabei verfolgen beide Maßnahmen grundlegend unterschiedliche Ziele:
- Datensicherung (Backup) dient dem Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen, etwa Cyberangriffen, Hardware, Ausfällen oder versehentlichem Datenverlust. Sie ermöglicht eine zeitnahe Wiederherstellung des aktuellen Systemzustands.
- Archivierung hingegen verfolgt das Ziel der langfristigen, revisionssicheren Aufbewahrung von Daten, etwa zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder für interne Nachweiszwecke.
Während Backups regelmäßig überschrieben oder rotiert werden, bleiben archivierte Daten unverändert und nachvollziehbar dokumentiert. Eine professionelle IT, Strategie trennt daher klar zwischen diesen beiden Funktionen, und stellt sicher, dass beide Anforderungen technisch wie organisatorisch sauber abgedeckt sind.
Backups als Faktor wirtschaftlicher Resilienz
Eine Investition mit hohem Wirkungsgrad
In vielen Unternehmen gilt die Datensicherung noch immer als technische Pflicht oder reine Kostenstelle, deren Nutzen sich nur schwer beziffern lässt. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Eine zuverlässige Backupstrategie schützt nicht nur digitale Informationen, sondern sichert betriebliche Abläufe, Umsätze und das Vertrauen von Kunden. Sie ist ein zentraler Baustein wirtschaftlicher Resilienz, besonders für kleine und mittlere Unternehmen.
Datenverlust ist nicht nur ein IT-Problem, sondern ein Geschäftsrisiko. Zahlreiche Unternehmen zählen Vorfälle wie Datenverlust, Systemausfälle oder Cyberangriffe zu den größten Risiken für ihre Geschäftstätigkeit. Neben direkten finanziellen Schäden treten häufig Produktionsunterbrechungen, Vertragsstrafen und langfristige Reputationsverluste auf. Besonders herausfordernd ist, dass viele Organisationen im Ernstfall keine klare Wiederanlaufstrategie haben und dadurch wertvolle Zeit verlieren.
Laut einer aktuellen Risikobewertung geben mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen an, dass Cybervorfälle zu ihren größten Sorgen zählen. Auch Betriebsunterbrechungen werden von über 30 Prozent als vorrangiges Risiko betrachtet. Die Kombination beider Faktoren führt in vielen Fällen zu besonders kritischen Situationen. Kleine und mittlere Unternehmen sind dabei häufig unzureichend vorbereitet, etwa durch fehlende Notfallpläne oder nicht getestete Wiederherstellungsverfahren.
Backup ist keine Ausgabe, sondern eine Absicherung. Die Kosten für eine professionelle Datensicherung sind planbar und im Vergleich zum potenziellen Schaden gering. Dazu gehören:
- Zentrale und automatisierte Sicherung aller Systeme
- Mehrstufige Speicherung an getrennten Standorten oder in der Cloud
- Klare Wiederherstellungsziele für Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit
- Regelmäßige Prüfungen zur Sicherstellung der Datenintegrität
Wer Ausfallkosten vermeiden will, sollte nicht nur in Technik investieren, sondern in eine tragfähige Backupstrategie, die den Betrieb auch im Krisenfall absichert.
Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens lassen sich Backuplösungen ab wenigen hundert Euro pro Monatumsetzen, deutlich günstiger als der potenzielle Schaden bei einem vollständigen Ausfall oder einer Ransomware-Attacke.
Wirtschaftlich denken heißt: Ausfälle vermeiden, nicht nur beheben. Backup ist kein reiner IT, Aufwand, es ist ein Mittel zur betrieblichen Kontinuität:
- Relevanz für Versicherbarkeit: Ohne nachweisbare Backupprozesse wird Cyberschutz oft nicht oder nur zu hohen Prämien versichert.
- Relevanz für Audit und Compliance: Backups sind Pflichtbestandteil für ISO, Standards (z. B. ISO 27001), KRITIS, Verordnungen und DSGVO, Dokumentation.
- Relevanz für Geschäftsführung: Wer für die IT verantwortlich ist, trägt auch Mitverantwortung für den wirtschaftlichen Fortbestand.
Eine fundierte Backup-Strategie ist damit ein betriebswirtschaftlicher Risikopuffer mit hohem Return-on-Investment: Sie benötigt Investitionen, aber ein Nichtvorhandensein kann existenziell teuer werden.
Praxislösung: Backuplösungen mit Erfahrung und strategischer Einbindung
Für eine wirksame Datensicherung braucht es nicht nur Technik, sondern auch ein durchdachtes Gesamtkonzept. Als Teil der GFAD-Unternehmensgruppe bietet alpha IT Solutions praxiserprobte Lösungen, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen abgestimmt sind. Dabei profitieren Kunden von einem breiten Kompetenznetzwerk, das technische Umsetzung, strategische Beratung und regulatorische Anforderungen nahtlos verbindet.
Typische Bestandteile einer solchen Lösung sind:
- Zentrale und automatisierte Sicherung physischer, virtueller und cloudbasierter Systeme
- Mehrstufige Backuparchitektur mit externen Speicherorten und integrierter Wiederherstellungslogik
- Protokollierung und Dokumentation zur Erfüllung von Prüfanforderungen und regulatorischen Vorgaben
- Persönliche Betreuung durch erfahrene Fachkräfte mit Praxiswissen aus mittelständischen IT-Strukturen
Durch die enge Einbindung in die GFAD-Gruppe lassen sich Backupstrategien nicht nur technisch solide, sondern auch organisatorisch wirksam und wirtschaftlich tragfähig gestalten.
Die alpha IT Solutions hat Ihre Antworten!
FAQs
Eine professionelle Backupstrategie umfasst klare Ziele zur Wiederherstellung (RTO/RPO), dokumentierte Zuständigkeiten, regelmäßige Tests, eine sichere Speicherarchitektur (z. B. georedundant oder immutable) und eine revisionssichere Dokumentation. Sie ist Teil der übergreifenden IT- und Geschäftsstrategie.
Die meisten Anbieter verfolgen das Shared-Responsibility-Prinzip. Das bedeutet: Für den Schutz und die Wiederherstellung der eigenen Daten ist das Unternehmen selbst verantwortlich. Papierkörbe oder Versionsverläufe bieten keine ausreichende Sicherheit bei Datenverlust oder Angriffen.
Backups dienen der kurzfristigen Wiederherstellung bei Ausfällen oder Angriffen. Archivierung hingegen sichert Daten langfristig und unverändert zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder interner Nachweispflichten. Beide Prozesse verfolgen unterschiedliche Ziele und müssen getrennt betrachtet werden.
Ungetestete Backups führen im Ernstfall häufig zu Datenverlust, weil sie defekt, unvollständig oder nicht schnell genug wiederherstellbar sind. Ohne regelmäßige Tests bleibt die tatsächliche Wiederanlauffähigkeit unklar – mit teils existenzbedrohenden Folgen für das Unternehmen.
Empfohlen wird eine vollständige Wiederherstellung mindestens einmal jährlich, ergänzt durch quartalsweise Teiltests. Zusätzlich sollten tägliche Monitoring-Prozesse etabliert werden, um Fehler, Anomalien oder Ausfälle frühzeitig zu erkennen.
Dennis Völzke
Dennis Völzke ist seit 2021 Teil des Teams, gestartet als Systemingenieur und seit 2023 als Account Manager. Technikbegeistert seit Kindertagen, ist er immer ganz vorne mit dabei, wenn es um neue Technologien geht. Ursprünglich ein oldenburger Nordlicht, wohnt er seit 2015 in seiner Wahlheimat Berlin und füllt mit seinem Faible für aktuelle Technologien den alpha Blog mit Leben.